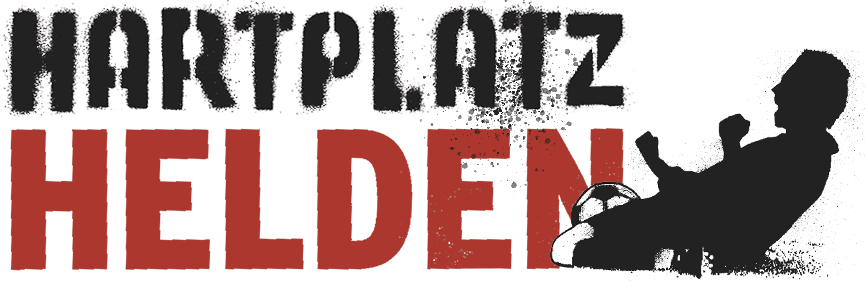„Deutsche Schiedsrichter pfeifen immer gegen Türken“
Mit einem emotionalen Plädoyer verabschiedete sich Schmerzspieler und Sympathieträger Lars Bender vor einigen Wochen am Fernsehmikrofon vom Profifußball. "So eine Fußballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie die Gesellschaft sein sollte. Einer ist für den anderen da, man steht füreinander ein. Völlig egal, wer da neben einem sitzt, wie er aussieht, was für eine Religion er hat, welche Ansichten oder was für einer Kultur er entspringt – zusammenstehen, nicht spalten lassen. Das ist die Botschaft, die ich senden möchte, und das ist das, was ich mitnehme aus meiner Karriere."
Ein wichtiges Statement. Und ein schönes Ideal, das es aber unter den Bedingungen des Leistungssports leichter hat, Realität zu werden. Wenn der Sport fast alles ist im Leben und der Erfolg der eigenen Fußballmannschaft beinahe ausschließlich darüber entscheidet, ob dieses Leben glücklich macht oder nicht, ist es einfacher, Vorurteile gegenüber Mit- und Gegenspielern über Bord zu werfen. Ressentiments lassen sich dann abtrainieren wie die paar Kilo Übergewicht nach dem Sommerurlaub.
Wenn aber, wie bei hunderttausenden Amateurkickern und -kickerinnen in Deutschland, sich das Leben vor allem außerhalb des Sports abspielt, wenn in diesem Leben so manches schiefläuft und man den Frust auf den Platz mitnimmt, lassen sich Vorurteile manchmal weniger gut unterdrücken. Dann lässt man seiner Abneigung gegenüber bestimmten Gruppen eher freien Lauf.
Vielfalt ist Normalität auf Deutschlands Amateurfußballplätzen. Keine andere Sportart versammelt so viele unterschiedliche Menschen unter ihrem Dach wie Fußball. Und das ist gut, so kommen Personen miteinander in Kontakt und bauen Beziehungen auf, die sich außerhalb des Fußballplatzes kaum begegnen.
Doch mit der Normalität der Vielfalt ist auch eine Komplexität verbunden. Ein ehemaliger Trainer von mir, ein Bosnier, sagte einmal in seiner Kabinenansprache vor einem Spiel gegen ein Team mit Türkeibezug zu uns: "Ich hoffe, dass der Schiedsrichter heute ein Deutscher ist. Deutsche Schiedsrichter pfeifen immer gegen Türken." Neben mir saßen zwei meiner türkischstämmigen Mitspieler.
Es gibt im Amateurfußball, eher als im Profifußball, Schiedsrichter, die Spieler aufgrund ihrer Herkunft anders behandeln als andere. Es gibt im Amateurfußball, eher als im Profifußball, Spieler, die aufgrund ihres familiären Hintergrunds und ihrer persönlichen Lebenssituation, zu aggressiven Verhalten auf dem Platz neigen.
Weil das Leben außerhalb des Sports auf dem Amateurfußballplatz eine Rolle spielt, weil dort gesellschaftliche Ungleichheiten und Konflikte eine Bedeutung haben, ist und bleibt Vielfalt im Amateurfußball eine Herausforderung. Gut gemeinte Plädoyers reichen leider nicht aus, um sie zu meistern. Vielfalt im Amateurfußball muss gestaltet und gemanagt werden. Dafür braucht es praxistaugliche Ansätze und engagierte Menschen.
Protokoll: Oliver Fritsch
Über das Thema dieser Kolumne wird Tim Frohwein am 22. Juli bei der nächsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Mikrokosmos Amateurfußball“ sprechen. Neben anderen Gästen wird auch der HARTPLATZHELDEN-Kolumnist Younis Kamil dabei sein. Hier kann man sich anmelden.
Wird man zum besseren Menschen, wenn man Fußball spielt?
Der Ball ruht, wann wieder trainiert und gespielt werden darf, ist unklar. Also habe ich mir gedacht, ich berichte über das, was mich derzeit beruflich beschäftigt. Das hat nämlich auch mit Fußball zu tun.
Als Jugendtrainer ist es immer mein Ziel gewesen, auch die Persönlichkeit meiner Spieler und Spielerinnen zu entwickeln. Ich habe dies immer aus der Überzeugung getan, dass der Fußball das ideale Medium ist, um Respekt, Toleranz und Teamwork zu vermitteln. Ich glaube, dass ich das in den fünfzehn Jahren meiner Trainertätigkeit nicht immer, aber doch meist geschafft habe.
Wenn man mich fragen würde, wie, würde ich sagen, dass ich das nicht mehr genau weiß. Erst in den letzten Jahren habe ich mich, bedingt durch meine berufliche Tätigkeit in der Jugendhilfe, systematischer damit auseinandergesetzt, wie ich den Fußball pädagogisch nutze. Und dennoch könnte ich auch heute nicht erklären, ob und warum mein Ansatz funktioniert.
Mein nächster beruflicher Schritt wird mir dabei eventuell helfen. Für die nächsten drei bis vier Jahre bin ich als Doktorand an der Vrije Universiteit Brüssel und darf mich wissenschaftlich mit der Frage auseinander setzen, ob (und wenn ja wie) der Fußball dazu beiträgt, dass junge Menschen zu gesellschaftlicher Teilhabe befähigt und vor dem Abdriften in kriminelle oder radikale Milieus bewahrt werden. Hat das Fußballspiel das Potenzial, diese großen gesellschaftlichen Aufgaben zu bewältigen, oder sind es die Faktoren um das eigentliche Spiel herum, die einen positiven Beitrag zum Zusammenhalt leisten?
Fußballverbände und soziale Organisationen schreiben dem Fußball oft per se ein integratives Potenzial zu. Aber ist das haltbar? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über die gesellschaftliche Wirkung des Fußballspiels? Wird man automatisch zum besseren Menschen, wenn man regelmäßig kickt?
Der Belgische Fußballverband (RBFA) möchte dem auf den Grund gehen und hat mit der Vrije Universität Brussel und dem Hannah-Arendt-Institut aus Belgien zwei akademische Einrichtungen damit beauftragt, dies zu erforschen. Mit dem Projekt „Belgian Red Courts” möchte der RBFA bis zu vierzig Minispielfelder in ganz Belgien renovieren und an diesen Spielfeldern sein Fußballprogramm ausrollen. Diese Minispielfelder sind nicht an Vereine gebunden, sondern öffentlich zugängliche kommunale Sportstätten.Der Belgische Fußballverband knüpft an das Programm zwei konkrete Ziele:
1. Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
2. Kriminalitäts- und Radikalisierungsprävention
Das Programm sieht vor, für jedes Minispielfeld zwei jugendliche Trainerinnen als Red Courts Coaches auszuwählen, und diese in der Umsetzung des Fußballprogramms zu schulen. Meine Aufgabe wird es sein, mit dem RBFA ein Programm zu entwickeln, das die Ziele des Verbandes anvisiert und Bedingungen schafft, damit sie erreicht werden können.
Wie muss das Programm aufgebaut sein? Reicht es nur, Fußball zu spielen, oder sollte nach einer Methode gespielt werden? Sollte es anschließend noch Gesprächsrunden geben, wie sollten diese gestaltet sein? Wie sollte die Beziehung zwischen Trainerinnen und Spielern gelebt werden? Worauf sollte man in der Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen achten? Welche sozialen und persönlichen Kompetenzen benötigen junge Menschen, um aktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden?
All diese Fragen werden mich in den ersten Monaten beschäftigen, immer wieder muss ich an die vielen kleinen Vereine an der Basis denken. Wie wunderbar wäre es, wenn ihnen dieses Wissen komprimiert und in praktischer Form zur Verfügung gestellt würde und unsere Trainerinnen und Trainer dieses Wissen in ihre tägliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen integrieren könnten?! Vereine könnten ihre gesellschaftliche Relevanz auf ein neues Level heben und selbstbewusst sagen: „Wir tragen durch unsere Arbeit zu gesellschaftlichem Zusammenhalt bei.”
Voraussetzung ist natürlich, dass die Forschungsarbeit Ergebnisse liefert. Aber selbst wenn es nicht die gewünschten sind, werden wir viele Hinweise bekommen, wie wir den Fußball nutzen können, um bei unseren Schützlingen mehr als nur die fußballerischen Skills zu entwickeln.
Gerne werden ich von Zeit zu Zeit in meiner Kolumne über den aktuellen Forschungsstand berichten. Dabei versuche ich, die Ergebnisse in die Praxis auf dem Platz zu übersetzen.
**
Wer mehr über das Projekt des Belgischen Fußballverbandes erfahren möchte, kann sich hier informieren.
Protokoll: Oliver Fritsch
Sie riefen „Deck den Weißen“ – das tat mir weh
Juni 2010, ein staubiger Sandplatz inmitten der Hauptstadt Sudans, 22 junge Männer, die einem Ball nachjagen und um den Sieg in einem Freundschaftsspiel zwischen zwei benachbarten Stadtvierteln spielen. Eine Szene, wie sie jeden Abend in Khartoum hunderte Male zu sehen ist. Nur eines ist auf diesem Platz anders. Einer der Spieler ist heller. Deutlich heller. In den Augen seiner Mitspieler ist er „weiß“. Dieser Spieler bin ich, denn ich bin im Sudan aufgewachsen und kehre immer mal wieder in meine Heimat zurück. Ich bin als Sohn eines Sudanesen und einer Deutschen im Sudan geboren und habe dort die ersten Lebensjahre verbracht.
Und so werde ich auch gerufen: „Khawaja“ eine im Sudan übliche Bezeichnung für Menschen helleren Hauttyps. Jedes Mal, wenn ich so gerufen werde oder den Kommentar der Gegner „Deck den Weißen!“ höre, tut es weh. Nicht viel, aber ein bisschen. Aus der Masse auf Grund eines äußerlichen Merkmals herausgehoben zu werden, fühlt sich nicht gut an.
„Khawaja“ wird im Sudan manchmal dafür verwendet, um „Weiße“ abfällig zu bezeichnen. Doch in diesem Fall, auf dem Fußballplatz, ist es nicht rassistisch gemeint. Das ist mir damals bewusst. Dennoch – es fühlt sich nicht gut an. Die Reduzierung auf die Hautfarbe, um identifiziert werden zu können, grenzt aus.
Ich muss umgehend an meine Erfahrung zurückdenken, als ich am 8. Dezember diesen Jahres das Champions-League-Spiel Paris St. Germain gegen Basaksehir Istanbul als mir langsam verfolge. Wie hat sich Pierre Webó, der Cotrainer Istanbuls, gefühlt, als er vom Vierten Offiziellen Sebastian Coltescu auf Grund seiner Hautfarbe identifiziert wurde? War das Rassismus oder einfach nur ein ungeschickter Ausdruck? Und kann etwas rassistisch sein, auch wenn es gar nicht so gemeint war?
Über die Vorfälle in Paris ist zur Genüge geschrieben worden, der rumänische Schiri musste viel Kritik einstecken, vielleicht ist seine Karriere zu Ende. Ich möchte versuchen, diese Vorfälle zu nutzen, um unseren Amateurfußball für das allgegenwärtige Thema Rassismus zu sensibilisieren. Auch Migranten sind übrigens nicht davor gefeit, sich rassistisch zu äußern.
Rassismus drückt sich nicht immer in Beleidigungen, Affengeräuschen oder Bananenwürfen aus. Es können bereits abwertende Blicke, unfreundliche Gesten oder bestimmte Begriffe sein, mit denen wir uns bezeichnen. Ausländer, Alman oder Schwarzer. Ich höre schon die Entgegnung: „Dann darf man ja gar nichts mehr sagen! Wenn er schwarz ist, wird man das wohl noch sagen dürfen! Ich habe ja auch kein Problem damit, wenn man sagt, „Deck den Rothaarigen da!“
Sollte man aber. Man sollte ein Problem damit haben, wenn einzelne Menschen auf Grund äußerer Merkmale aus einer Masse herausgehoben und damit bloßgestellt werden. Vor allem dann, wenn man nicht sicher ist, ob diese Person damit einverstanden ist. Vielleicht ist der Rothaarige sein Leben lang auf Grund seiner Haarfarbe gehänselt worden, wird nun erneut auf dem Platz damit konfrontiert und ist möglicherweise durch diese Wortwahl verletzt.
Und weil wir bei unserem rothaarigen Mitspieler es nur vermuten können, wir aber ganz sicher wissen, dass Schwarze und People of Colour kollektiv und systematisch diese Erfahrungen gemacht haben und heute immer noch machen, sollten wir besonders sensibel sein, wenn es um sie geht: Denn die Bezeichnung „schwarz“, selbst wenn sie nur zur Identifizierung genutzt wird, muss im historischen Kontext betrachtet werden. Dieses Wort hat durch Kolonialismus, Sklaverei und Apartheid deutlich mehr Bedeutung als eine Farbe. In diesem Wort schwingen systematische Benachteiligung und Reduzierung auf äußerliche Merkmale mit. Zwar ist die Bezeichnung als Alman oder Kartoffel häufig auch abschätzig gemeint. Aber der große Unterschied besteht darin, dass sich Rassismus insbesondere dort bemerkbar macht, wo es um Privilegien geht, wo es um strukturelle Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen geht. Rassismus wirkt „von oben nach unten“.
Insbesondere Menschen, die schon häufig Rassismus erlebt haben, reagieren auf dieses Wort besonders verletzlich. In einem vertrauten oder respektvollen Umfeld, ist seine Nutzung unproblematisch, da sie von Schwarzen Menschen selbst gewählt wurde, wie wir beispielsweise an der Black Lives Matter Bewegung erkennen. In dem Moment, in dem aber nicht mehr klar ist, wie das Gesagte im Grunde gemeint ist, kann daraus schnell ein Missverständnis entstehen.
Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, wäre mein Vorschlag, auf jegliche Bezeichnungen, die das Äußere in den Vordergrund stellen, zu verzichten. „Deck die Nummer 10!“ ist doch eine gute Alternative. Bestenfalls kenne ich sogar den Namen des Gegenspielers. Damit erkenne ich nämlich jeden auf dem Feld als ein Individuum an.
Im Grunde sollten wir uns darüber einig sein, dass wir uns auf dem Platz mit Respekt begegnen wollen und keinen Mitspieler, Gegenspielerin, Schiedsrichterin oder Zuschauer durch unsere Worte oder Taten verletzen wollen. Wenn wir das beherzigen, können wir uns sogar einen Ausrutscher erlauben, der dann nicht so stark ins Gewicht fällt. Weil wir bereits eine Vertrauensbasis haben.
Was hätte der rumänische Schiri Sebastian Coltescu tun können, um die Situation in Paris zu retten? Wäre er auf Pierre Webó zugegangen, hätte sich entschuldigt, ihn vielleicht sogar umarmt, hätte er zugegeben, dass er diesen Fehler nur aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit begangen hat, bin ich ziemlich sicher, dass das Spiel fortgesetzt statt abgebrochen worden wäre. Wir würden nicht über einen Rassismusskandal sprechen, sondern über Respekt und Größe.
Diese Chancen werden sich uns im Amateurfußball immer wieder bieten und wir sollten sie nutzen. Uns an der Fußballbasis geht es letzten Endes um die Atmosphäre, die wir auf unseren Plätzen schaffen möchten. Eine freundliche Begrüßung vor dem Spiel durch den Vorsitzenden, ein nettes Wort zwischendurch und öffentlichkeitswirksame Aktionen, die deutlich zeigen, dass Rassismus auf unseren Spielfeldern keinen Platz hat, wirken Wunder.
Aber auch den Verbänden kommt dabei eine nicht zu vernachlässigende Verantwortung zu. Wenn ich mir die Führungsetagen der Uefa oder des DFB anschaue, sehe ich nicht die große Vielfalt. Die Verbände können nur dann authentisch eine respektvolle und von Vielfalt geprägte Atmosphäre auf den Fußballfeldern Europas einfordern, wenn sie etwas vorleben. Solange dieses Ungleichgewicht herrscht, wird es immer wieder Momente geben, in denen sich Einzelne strukturell benachteiligt fühlen und sich Konflikte an einzelnen Worten entzünden.
Protokoll: Oliver Fritsch
Duschen nach dem Spiel ist jetzt gefährlicher als nach dem Training
Es reicht. Dieser Gedanke kommt vielen Vorständen von Fußballvereinen in den letzten Wochen häufig in den Kopf. Immer neue Corona-Verordnungen führen zu immer neuen Anordnungen. Die Politik irrlichtert, viele Behörden kommunizieren unklar, sind oft selbst nicht auf dem Stand der Dinge. Auf den Plätzen steigt die Wut, weil niemand mehr Planungssicherheit hat. Die Stimmung in den Vereinen wird negativer, das Binnenklima ruppiger. Vorstände verzweifeln an Trainern, Trainer an Spielern, alle zusammen an Eltern. Aber es ist ja auch schwer zu verstehen, warum die ihren Kindern manchmal zusehen dürfen, manchmal nicht.
In Berlin haben wir eine Gesundheitsbehörde, die nach der Demo der Corona-Leugner Ende August Stärke zeigen will. Die verstrahlten Protestler werden darüber nur lachen, doch getroffen werden von den fraglichen, unplausiblen Verschärfungen unter anderem die Fußballer. Drei Beispiele:
- Nach dem Training darf (mit Mindestabstand) geduscht werden, nach
Punktspielen nicht.
- Bei eintrittspflichtigen Spielen müssen Anwesenheitslisten geführt
werden, bei Spielen ohne Eintritt nicht.
- Vor Punktspielen dürfen die Teams erst dreißig Minuten vor dem Anpfiff
die Sportanlage betreten.
Dass freier Eintritt statt der üblichen 50 Leute vielleicht 80 anlockt, spielt keine Rolle. Man muss auch keine sportmedizinischen Fachkenntnisse besitzen, um zu wissen, dass eine minimale Erwärmungsdauer ein riesiges Verletzungsrisiko darstellt. Aufgrund einer Anordnung der Gesundheitssenatorin kann man eigentlich gleich einen Rettungswagen zum Platz rufen. Und ist Duschen nach dem Spiel gefährlicher als nach dem Training?
Auch in anderen Bundesländern, so ist zu lesen, treibt der Wahnsinn Blüten. Das alles muss man als Vorstand erstmal verstehen und hinnehmen – und dann auch noch seinen Leuten vermitteln. Wer kann einem Ü-50-Spieler erklären, er dürfe die Kabine nicht nutzen, während zeitgleich die A-Jugendlichen duschen?
Kommunikation ist schon immer anspruchsvoll gewesen, doch in diesen Tagen selbst für Profis kaum noch beherrschbar. Immer mehr Kanäle machen es einem nur vordergründig leichter. Eigentlich wird es immer komplizierter. Während sich viele Ältere inzwischen an E-Mails gewöhnt haben, kommunizieren andere vor allem über Social Media, wieder andere nur noch per Handydienst. Und dann gibt es ja auch noch eine Reihe von Tools zur Organisation von Trainingsgruppen.
Für die Jugendleitungen und Vorstände ist es daher zurzeit umso wichtiger, dass sie sich auf ihre Multiplikatoren im Verein verlassen können. Aber wenn ein Verband am Donnerstag um 21 Uhr eine Info-Veranstaltung beendet und die ersten Spiele am Samstag um 9 stattfinden, bleiben gerade mal sechsunddreißig Stunden, um alle wichtigen Neuigkeiten weiterzureichen. Da die meisten Ehrenamtlichen arbeiten, ist das kaum zu bewerkstelligen. Vom Privatleben ganz zu schweigen.
In den Verbänden, die sich immer weiter von der Basis entfernen, sitzen zudem wenige Praktiker. Jede Kommunikation stößt nämlich an Grenzen, wenn ein Verband – wie in Berlin geschehen – zwei Tage vor dem Wochenende den Spieltag komplett absetzt und beschließt, nur noch eine einfache Runde zu spielen, die Saison also zu halbieren. Dann muss man vor allem erstmal den Frust der Aktiven bewältigen.
Zum Saisonauftakt von RB Leipzig hingegen dürfen, dank der Lobby des Profifußballs, 8.500 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion. Dabei teilen Bayern und Sachsen eine Landesgrenze. Die Tatsache, dass 800 Besucher in einem geschlossenen Dortmunder Saal einem Konzert beiwohnen durften, bleibt den ohnehin schon verärgerten Vereinsmitgliedern auch nicht verborgen. Der Eindruck verstärkt sich, dass Amateurfußball nicht mehr viel zählt. Dabei wären sieben Millionen DFB-Mitglieder, davon rund die Hälfte aktive Sportlerinnen und Sportler, eine hochinteressante Zielgruppe für die an Politikverdrossenheit leidenden Parteien. Sicher, auch vielen Vereinen ist vorzuwerfen, den Fokus zu sehr auf die 1. Herren zu legen. Aber wer kann sich an Statements von Politikern erinnern, die den Wert einer Kinder- und Jugendarbeit im Fußball oder den integrativen Faktor des Sports hervorheben?
In Sonntagsreden hieß es früher: „Sportvereine sind Schulen der Demokratie.“ Diese Erkenntnis scheint verloren zu gehen, was sich in der Zeit, in der sich viele in die Arme von Leuten treiben lassen, die die Demokratie ablehnen, als fatal herausstellen könnte. Dass sie mehr werden – auch das erkennt man zurzeit in manchem Fußball-Forum.
Protokoll: Oliver Fritsch
Flüchtlingsmannschaften machen mich skeptisch
Ein Beispiel aus meiner Erfahrung als U17-Trainer, das zeigt, welche Integrationskraft der Fußball hat: Eines Tages stand ein stark traumatisierter junger Mann aus Afghanistan vor mir, der gerade in einem nahe gelegenen Waisenhaus unter gekommen war. Technisch talentiert, aber spieltaktisch ohne Hintergrund. Er wurde Teil des Teams und blühte auf wenn er auf dem Platz stand. Nach zwei Jahren wechselte er den Verein. Zufälligerweise traf ich den nun schon jungen Erwachsenen kürzlich am Fußballplatz. Er steht kurz vor dem Abschluss einer Ausbildung zum Bäcker. Außerdem bildet er als ehrenamtlicher Snowboardlehrer wiederum junge Flüchtlinge am Snowboard aus. Was für eine Geschichte.
Der Fußball hat ihm auf seinem Weg geholfen. Auf und neben den Spielfeldern der Republik finden Menschen zusammen. Unabhängig von sozialer Schicht, Herkunft, Sprache oder Religion. Fußball integriert. Dennoch werde ich skeptisch, wenn ich von einem neuen Phänomen höre: den Flüchtlingsprojekten, deren Mannschaften ausschließlich aus Geflüchteten bestehen. Natürlich bekommen die jungen Männer dadurch einen Anker in ihrem Leben, der ihnen etwas Halt gibt. Andererseits handelt es sich auch um eine Abschottung, die eine größere Chance vergibt. Das Erlernen der Sprache, der Kontakt zu Einheimischen, das Schließen von Freundschaften, das Einleben in Vereinsstrukturen – all dies ist in reinen Flüchtlingsprojekten schwer umzusetzen.
Flüchtlingsmannschaften erinnern mich an die Spiele in den Achtzigern gegen monoethnische Vereine aus der Türkei oder Griechenland. Daran denke ich ungern zurück, denn das waren oft keine Spiele, die der Integration dienten. Das war Klassenkampf und nationalistisch geprägter Sport, nicht selten von Polizeieinsätzen begleitet. Freilich, wir haben denselben Sport ausgeübt, in derselben Liga, aber als Spieler habe ich solche Duelle immer gefürchtet, weil Fußball nicht im Mittelpunkt stand. Insofern bedeuten monoethnische Vereine keine vollständige Integration, sondern nur (oder immerhin) eine halbe.
Das ist lange her. Mittlerweile sind daraus anerkannte Vereine geworden, die in der Regel so multiethnisch geprägt sind, wie alle anderen Vereine auch. Auch wenn es nach dem Balkankrieg noch einmal zu einer kleinen Renaissance kam. Heute sind das im Normalfall problemfreie Spiele, auch weil es die Mischung macht. Beim neuen Drittligisten Türkgücü München zum Beispiel sind die meisten Spieler und Funktionäre gar nicht mehr türkisch, viele sind deutsch. Dass jetzt Neonazis gegen diesen Verein hetzen, zeigt wieder mal nur, dass die keine Ahnung von Fußball haben.
Sonderprojekte mögen gut gemeint sein. Doch ich sehe wesentlich größere und schnellere Chancen für Geflüchtete, wenn wenn sie sich bereits bestehenden, traditionellen Vereinen anschließen. Dort können sie all die Vorteile genießen, die ein Vereinsleben bietet, nicht zuletzt soziale Kontakte weit über den Fußballplatz hinaus. Die Vereine wiederum müssen sie unabhängig von Herkunft und Migrationsgeschichte mit offenen Armen empfangen, auch mal auf sie zugehen. Dann, in der Normalität des täglichen Vereinslebens, kann der Fußball seine volle Integrationskraft entfalten.
Protokoll: Oliver Fritsch