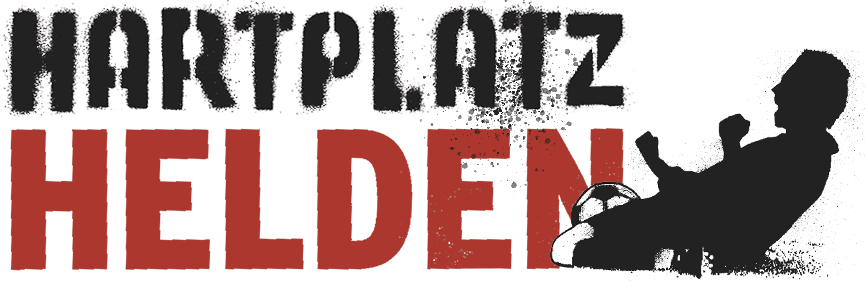Trainer und Trainerinnen gesucht, und noch vieles mehr
Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf freut sich über steigende Zahlen im Kinder- und Jugendfußball. Zurecht, denn sie zeigen, dass der Amateurfußball für die Jüngsten und deren Eltern trotz Corona nicht an Attraktivität verloren hat. Auch wenn die Pandemie uns noch lange beschäftigen wird, strömen Kinder in die Vereine. Wir haben beim FC Internationale die Wartelisten für Jungen geschlossen. Es hat keinen Sinn, hunderte von Kindern drauf zu setzen, wenn es unwahrscheinlich ist, die Nachfrage in den nächsten Monaten ansatzweise befriedigen zu können.
In den Ballungsräumen sind oft fehlende Platzkapazitäten ein Problem. Doch die größte Gefahr lauert bei der zunehmend schwierigeren Gewinnung von Trainerinnen und Trainern. Zwar wird das Ehrenamt gern als Rückgrat der Gesellschaft bezeichnet, doch Strategien für die Stärkung des Engagements sind kaum in Sicht.
Glaubt man Statistiken, betätigen sich nicht weniger Menschen als früher im Ehrenamt. Sieht man genauer hin, stellt man deutliche Veränderungen fest. Die Bindungen werden kürzer. Temporär zeigen die Leute Einsatz, etwa bei der Organisation eines Sommerfestes oder dem Streichen von Klassenräumen. Langfristige Bindungen büßen jedoch an Attraktivität ein. Viele Vereine finden keine Schatzmeister oder ehrenamtliche Jugendleitungen. Das führt dazu, dass die Vielfalt im Vereinswesen zurückgeht, viele Clubs sich nur noch um den Sport für Erwachsene kümmern, ohnehin große immer noch größer werden. Auch die Suche nach Trainerinnen und Trainern oder Unparteiischen wird schwieriger, gerade für untere Teams, eine D6 oder C4.
Die Gründe sind vielfältig. Einerseits gibt es einen Rückzug ins Private, andererseits ist es der Arbeitsmarkt, der den Vereinen zu schaffen macht. In vielen Regionen herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Weil Fachkräfte fehlen, führt das zu Überstunden, die mit dem Ehrenamt konkurrieren. Selbst Studierende finden weniger Zeit, sie müssen arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren. Wer nach der Vorlesung fünf Stunden an der Kasse eines Supermarktes sitzt, um die steigenden Wohnungspreise zahlen zu können, kann nicht auf dem Fußballplatz stehen. Zwar gibt es Studien, die zeigen, dass Menschen, die immer nur auf ihren Vorteil bedacht sind, scheitern. Erfolgreich in Job und Privatleben sind diejenigen, die auch an andere denken. Doch in der Praxis genießen die Finanzierung von Miete, Ernährung und Urlaub eine höhere Priorität.
Pfingsten war ich auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing zur „Zukunft der Zivilgesellschaft“. Dort brachte Professor Edgar Grande, ein begeisterter Fußballfan, die zunehmende Zahl von Ichlingen ins Gespräch. Armin Käfer schreibt in der Stuttgarter Zeitung: „Ich ist das neue Wir. Jeder will, soll, muss etwas Besonderes sein. Selbstsuch wird von der Unsitte zur Tugend, Rücksichtslosigkeit zum Rollenmodell.“ Dazu passt die Studie von Doktorin Birthe Tahmaz, die Auswirkungen der Pandemie auf die Zivilgesellschaft untersucht hat. Im Lockdown waren plötzlich neue Kompetenzen gefragt: digitales Training, Bindung von Mitgliedern und Engagierten trotz fehlender Angebote, aber auch Durchhaltestrategien für die Coaches. Tahmaz zeigt, dass zu Beginn des Lockdowns 2021 kaum Engagierte kündigten. Im September war die Quote aber von 4 auf 14 % gewachsen, ein Anstieg von 350 % (!). Und noch eine Zahl alarmiert: Das Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen einer sehr großen Wohlfahrtsorganisation liegt inzwischen bei 68.
Was folgt daraus? Wir müssen in eine Debatte um das Gemeinwohl und das Engagement einsteigen. In Zeiten von Pandemie, Krieg und Inflation braucht es eine breite gesellschaftliche Diskussion, die unseren Zusammenhalt stärkt. Die Sportverbände wären gut beraten, sich an die Spitze zu setzen. Dabei dürfen sie durchaus fordernder sein als bisher. Denn wenn der „Sportverein als Schule der Demokratie“ bezeichnet wird, kann diese Institution gar nicht genug gefördert werden. Gleichwohl sind die Kassen leer, obwohl für elitäre Großprojekte immer noch genug Geld da ist.
Alleine wird der Staat die Misere nicht lösen können. Es braucht neue, lokale Allianzen. Hier ist nicht zuletzt die Wirtschaft gefordert. Fußballvereine bieten Potenzial: für die Gewinnung von Fachkräften, für die Vermittlung von Soft Skills, für die Aufwertung des Standorts, für die Förderung der Gesundheit. Förderung oder Sponsoring sollte sich vor allem auf die Stärkung der Struktur konzentrieren, weniger auf einzelne Projekte oder gar die Bezahlung von Spielern. Nur wenn die Rahmenbedingungen im Verein stimmen, können Maßnahmen gelingen, kann sich nachhaltig sportlicher Erfolg einstellen.
Vereine sind gleichwohl gut beraten, sich gegenüber Förderern offen zu zeigen, wenn es um die Entwicklung von Perspektiven geht. Denn am Ende wollen alle einen Mehrwert, brauchen alle das Gefühl einer Win-Win-Situation. Apropos nachhaltig: In der Zukunftscharta Grüner Hirsch, die wir mit Unternehmen, Politik und Verwaltung in unserem Bezirk erarbeitet haben, heißt der Slogan: „Kurze Wege in die Zukunft“. Die großen Verbände und die überregionale Politik darf man nicht aus der Verantwortung entlassen, doch die Solidargemeinschaft entsteht am besten vor der Haustür.
Links:
https://www.bz-berlin.de/meinung/kolumne/berliner-helden/wir-amateursportler-brauchen-neue-allianzen
https://www.ziviz.de/sites/ziv/files/engagement-barometer_corona_erste_panelbefragung.pdf
Meet the Ref!
Der Streikaufruf der „Interessengemeinschaft Schiedsrichter“ für den 15. Mai hat Diskussionen im deutschen Amateurfußball nach sich gezogen. Nach zuletzt mehreren Berichten über Übergriffe gegen Unparteiische sei es an der Zeit, „dass sich Schiedsrichter gegen Gewalt zur Wehr setzen und für einen Tag die Pfeife ruhen zu lassen“, schrieb die Schiedsrichter-Lobby in einer vielbeachteten Pressemitteilung.
Und selbst wenn am Ende – auch weil die Verbände sich unmittelbar gegen die Protestaktion positionierten und sie als „keine zielführende Maßnahme“ bezeichneten – kaum Unparteiische dem Aufruf gefolgt sein dürften: Dass die Schiedsrichterei auf Deutschlands Fußballplätzen oft ein undankbarer, mitunter gefährlicher Job ist, daran gibt es keinen Zweifel.
Nicht zuletzt deswegen wollen diesen Job immer weniger Menschen machen: Zur Saison 2016/17 gab es noch 59.022 aktive Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Deutschland, in der Spielzeit 2020/21 waren es nur noch 44.821. Das entspricht einem Rückgang von rund 24 Prozent. Der deutsche Fußball hat also in vier Jahren ein Viertel seiner Schiedsrichter verloren – eine traurige Zahl, wenn man bedenkt, dass das Spiel ohne jemanden, der sich um die Einhaltung der Regeln kümmert, nicht funktioniert (ähnlich dürfte wohl auch eine Gesellschaft ohne Polizeibeamte nicht funktionieren).
Der alarmierende Schiedsrichtermangel ist zum Teil sicherlich auf das von der IG Schiedsrichter angemahnte raue Klima auf den Fußballplätzen zurückzuführen, das zeigt auch die Forschung: Laut einer Umfrage der Tübinger Soziologin Thaya Vester sind rund 40 Prozent der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter schon mal Opfer von Bedrohungen geworden, knapp jede oder jeder fünfte wurde bereits tätlich angegriffen. In einer Ausgabe der von mir organisierten Diskussionsreihe „Mikrokosmos Amateurfußball“ im letzten Sommer (hier eine Aufzeichnung der Veranstaltung) sagte die Forscherin Thaya Vester mit Blick auf diese Befunde: „Gewalt im Fußball ist eigentlich fast gleichzusetzen mit Gewalt gegenüber Schiedsrichtern.“
Der fehlende Respekt gegenüber Unparteiischen, der oft Ursache für diese Gewalt ist, ist meiner Meinung nach verwurzelt in der Fußballkultur und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Ich erinnere mich an einen Trainer, den ich fußballerisch wie fachlich durchaus geschätzt habe, der uns nahezu vor jedem Spiel in der Kabinenansprache mitgab, dass wir den Schiedsrichter doch bitte schön in Ruhe lassen sollten – aber eben nicht aus Respekt. Er sagte: „Die sind anders als wir. Die können kein Fußball spielen, die verstehen uns und diesen Sport gar nicht.“
Ich habe das damals durchaus verinnerlicht und bin mit dieser Einstellung viele Jahre auf dem Platz unterwegs gewesen, ähnlich wie vermutlich viele meiner Mitspieler. Heute weiß ich aus Gesprächen mit Unparteiischen: Selbst wenn ein Schiedsrichter deshalb Schiedsrichter geworden ist, weil ihm das Talent für das Fußballspielen gefehlt hat, macht er seinen Job auch deswegen, weil er diesen Sport genauso liebt wie ich. Deshalb möchte er Teil des Spiels sein.
Ich glaube, wenn Fußballspieler mehr mit Schiedsrichtern sprechen würden, wenn sie den „Menschen hinter der Pfeife“ besser kennenlernen würden, dann würden sie diese Motive bei den Unparteiischen erkennen. Doch wie kommt dieser Dialog zustande?
Ein Vorschlag: Vereine könnten einmal pro Saison anstelle der Mannschaftsbesprechung einen Austausch mit einem Schiedsrichter oder einer Schiedsrichterin organisieren. Ein Moderator, zum Beispiel gestellt vom Verband, sorgt für eine neutrale und konstruktive Gesprächsatmosphäre, in der sich beide Seiten besser kennenlernen und Verständnis füreinander entwickeln können.
Wäre das nicht eine „zielführende Maßnahme“? Könnten Verbände nicht eine entsprechende Kampagne aufsetzen und in die Fläche tragen? Ich hätte schon einen Titel für das Projekt: „Meet the Ref!“
Die große Bezahlunkultur
"Das war doch schon immer so!", heißt es oft, wenn das Thema Geld im Amateurfußball zur Sprache kommt. Ein Satz, mit dem man gerne kritische Auseinandersetzung im Keim ersticken will. Das ist schade – und gefährlich, denn: Aus dem Sein folgt schließlich kein Sollen.Vielleicht erscheint der Ist-Zustand der Bezahlkultur im Amateurfußball veränderungswerter, wenn man ihr Ausmaß besser versteht. Mit den Ergebnissen der Correctiv-Studie „Wie viel verdienen Amateurfußballer?“, die ich wissenschaftlich begleiten durfte, ist das jetzt möglich. Mehr als 8000 aktive, männliche Amateurkicker aus ganz Deutschland haben zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 bei der anonymen Umfrage mitgemacht. Einige Zahlen aus der Studie wurden bereits in der ARD-Doku Milliardenspiel Amateurfußball publik gemacht. Hier nochmal ein Überblick über die aus meiner Sicht wichtigsten Befunde:
- Mehr als ein Drittel (36,9 Prozent) der Teilnehmer wurde zur Zeit der Befragung bezahlt.
- Mit zunehmendem Leistungsniveau steigt der Anteil der bezahlten Spieler. Von den 1430 Befragten, die zur Zeit der Erhebung in der 7. Liga spielten, wird eine knappe Mehrheit (50,9 Prozent) bezahlt. Damit scheint die 7. Liga – in vielen Fußball-Regionen entspricht das der Bezirks- oder Landesliga – eine Art Grenze zwischen dem unterklassigen/geselligkeitsorientierten und dem höherklassigen/leistungsorientierten Amateurfußball zu markieren.
| Regionalliga (4. Liga) | 90,0 % |
| 5. Liga | 89,9 % |
| 6. Liga | 76,7 % |
| 7. Liga | 50,9 % |
| 8. Liga | 36,4 % |
| 9. Liga | 19,9 % |
| 10. Liga | 9,4 % |
| darunter | 7,3 % |
- Angaben zur Höhe des monatlichen Verdiensts im Oktober 2020 machten 2790 Umfrageteilnehmer. In diesem Monat wurde an die bezahlten Spieler ein Gesamtbetrag von 1.160.657 Euro ausgeschüttet, also etwa 416 Euro pro Spieler. Auf eine Saison mit zehn Verdienstmonaten gerechnet kommt man in ganz Deutschland auf mehr als eine Milliarde Euro, die an Amateurfußballer fließen.
- Mit dem Leistungsniveau steigt nicht nur der Anteil an bezahlten Spielern, sondern auch der Durchschnittsverdienst:
| Regionalliga (4. Liga) | 1627 € |
| 5. Liga | 697 € |
| 6. Liga | 425 € |
| 7. Liga | 309 € |
| 8. Liga | 250 € |
| 9. Liga | 241 € |
| 10. Liga | 362 € |
| darunter | 311 € |
- Interessanterweise steigt der Durchschnittsverdienst in den untersten Ligen nochmal an. Meine Interpretation: Wie die Tabelle oben zeigt, gibt es in den tiefsten Ligen weniger Spieler, die Geld bekommen – aber die lassen sich ihr Engagement dafür eben richtig gut entlohnen. Ich habe sie oft gesehen, die Ex-Verbandsliga-Spieler, die im gehobenen Alter nochmal durch die unteren Ligen tingeln. Sportlich oft ein Gewinn, menschlich nicht immer.
- Spieler, die Geld erhalten, unterscheiden sich von Spielern, die nicht bezahlt werden. Erstgenannte wechseln beispielsweise häufiger den Verein: Spieler, die zur Zeit der Befragung Geld erhielten, liefen in ihrer bisherigen Karriere durchschnittlich für 3,0 Vereine auf. Unbezahlte Amateurfußballer im Durchschnitt nur für 2,2 Vereine. Auch die geselligen Begleiterscheinungen des Amateurfußballs schätzen bezahlte Spieler weniger: Der Aussage „Beinahe nach jedem Spiel sitze ich mit meinen Mitspielern in geselliger Runde zusammen“ stimmen bezahlte Amateurfußballer im Durchschnitt zu 68,3 Prozent zu, unbezahlte Spieler dagegen zu 83,5 Prozent.
Ja, es stimmt, die Ergebnisse einer Online-Befragung sind selten repräsentativ. Und manch ein Teilnehmer wird beim Ausfüllen des Fragebogens auch falsche Angaben gemacht haben. Aber dass wahnsinnig viel Geld im Amateurfußball unterwegs ist, ist nach diesen Befunden eindeutig. Gerade in den unteren Ligen, in denen der Spaß an der Bewegung, die Geselligkeit und das Miteinander an erster Stelle stehen sollten, braucht es aber keine Kicker, die sich nach Stationen im höherklassigen Amateurfußball ihren Karriereabend in der Kreisklasse gut bezahlen lassen – nur weil ein Mäzen denkt, dass seine Mannschaft statt in der 10. Liga in der 8. Liga spielen sollte.
Steckt das Geld lieber in die Digitalisierung, die sportliche Infrastruktur und den Jugendbereich eures Vereins! Stellt hauptamtliche Mitarbeiter ein! Es gibt in Deutschland schon zahlreiche Vereine, die diesen Weg gehen und sich vom System Bezahlkultur (das man eher als Bezahlunkultur bezeichnen sollte) verabschiedet haben. Sie sollten sich vernetzen, auf diese Weise sichtbarer werden und anderen Vereinen demonstrieren, dass Amateurfußball auch funktioniert, wenn man es anders macht, als es angeblich schon immer war.
Eine ausführliche Zusammenfassung der Studie wird im Februar in der Fachzeitschrift „Leipziger Sportwissenschaftliche Beiträge“ veröffentlicht.
Joshua Kimmich und seine fragliche Vorbildrolle
Es war fast ein Coming Out. Getrieben durch einen Leak der größten deutschen Boulevardzeitung offenbarte sich Joshua Kimmich als ungeimpfter Impfkritiker. Groß war das Entsetzen, zuletzt drückte Paul Breitner seine Fassungslosigkeit über Kimmich aus. Ebenso groß war der Aufschrei der politischen Großdeuter, die in Kimmich das Opfer einer angeblichen Hetzkampagne sehen.
Die Vorsitzende des Ethikrats Alena Buyx hat sich zu Kimmich geäußert, Richard David Precht philosophierte mit, Angela Merkel wurde nach ihrer Meinung gefragt. Doch über den Breitensport sprach wieder mal niemand. Dabei hat der Amateurfußball bekanntlich große Sorgen. Der Zuschauerandrang war schon vor Corona vielerorts bescheiden, inzwischen ist er eher noch zurückgegangen. Nun müssen sogar immer häufiger infektionsbedingt Spiele verlegt werden.
Daher darf durchaus diskutiert werden, ob Kimmich, der vielleicht die deutsche Nationalelf bei der Heim-EM 2024 als Kapitän anführen wird, mit seinem Gerede von möglichen Langzeitfolgen der Impfung dem Pandemiegeschehen im Amateurfußball Vorschub leistet. Es darf auch diskutiert werden, welche Verantwortung prominenten Fußballern zukommt – gerade jetzt, wo steigende Infektionszahlen und sich füllende Intensivstationen leider wieder Schlagzeilen machen und man sich fragt, ob wir zu leichtfertig im Umgang mit dem Virus geworden sind.
Natürlich steht es alleine Kimmich zu, über seine Immunisierung zu entscheiden. Dies entbindet ihn aber nicht von seiner Vorbildfunktion gegenüber Millionen Fans wie aktiven Fußballerinnen und Fußballern. Es muss ihm bewusst sein, dass er mit seiner Stellungnahme gegen die Impfung Einfluss auf die Entscheidung vieler anderer Menschen nimmt.
Und hier endet auch mein Verständnis für seine Aussage, die möglicherweise anderen Menschen indirekt massive gesundheitliche Probleme bringt. Ich würde mir wünschen, dass gerade Sportler verantwortungsvoll mit ihrer Rolle als gesellschaftliche Vorbilder umgehen. Politiker und Politikerinnen natürlich auch.
Selbst Menschen ohne Migrationsgeschichte werden diskriminiert
Tim Frohwein schrieb in seiner letzten HARTPLATZHELDEN-Kolumne „Deutsche Schiedsrichter pfeifen immer gegen Türken“ dass Vielfalt eine Aufgabe ist, die gemanagt werden muss. Das muss sie tatsächlich. Denn Nichtstun, Weggucken und Verschweigen lösen das Problem nicht. Im Gegenteil, es führt dazu, dass sich Rassismus und Diskriminierung in einer zunehmend polarisierten Atmosphäre schleichend einen Platz auf und neben deutschen Fußballplätzen sichern.
Bevor wir allerdings die Frage stellen, wie wir Wertschätzung von Vielfalt und Zusammenhalt fördern, müssen wir uns erst gestehen: Diskriminierung auf deutschen Fußballplätzen ist real. Sie findet statt, täglich, gegen unterschiedliche Gruppen unserer Gesellschaft. Schwarze, Muslime, Homosexuelle, Frauen, Übergewichtige, sozial und wirtschaftlich benachteiligte Gruppen, aber selbst Menschen ohne Migrationsgeschichte werden von Menschen mit Migrationsgeschichte diskriminiert.
Wer von uns hat nicht schon mal mindestens einen der folgenden Sätze gehört?
- „Bei Muslimen musst du nur mal leise die Mutter beleidigen, dann rasten die aus.“
- „Gegen die Deutschen treten wir möglichst aggressiv auf, dann machen die sich in die Hose.“
- „Die Frauen können gerne Fußball spielen, dann haben wir zumindest was zu gucken.“
- „Wenn ich auf dem Spielbericht sehe, dass mehr als die Hälfte aller Spieler Ausländer sind, ziehe ich zur Abschreckung bei der ersten Aktion die Gelbe Karte“ (sagte einst ein Schiedsrichter zu mir).
Eine Studie im Auftrag des Belgischen Fußballverbands hat herausgefunden, dass 36 Prozent aller Jugendspieler und -spielerinnen schon mal Opfer von Diskriminierung waren und sogar 95 Prozent aller Befragten:innen schon mal Gewalt auf Fußballplätzen erlebt haben. Die Zahlen dürften in Deutschland ähnlich sein.
Meiner Meinung nach werden wir Diskriminierung jeglicher Form nur in den Griff kriegen, wenn wir es aus zwei Richtungen angehen. Wir brauchen einerseits präventive Maßnahmen, die frühestmöglich unsere Kinder und Jugendlichen sensibilisieren. Andererseits müssen wir drastisch gegen Diskriminierungsfälle vorgehen, und zwar top-down. Angefangen beim DFB, über die Verbände, die Kreise bis in jeden einzelnen Verein darf Diskriminierung nicht mehr als Kavaliersdelikt verstanden werden und unter der Kategorie „Alles halb so wild, wir sind ja hier beim Fußball und nicht beim Ballett, da geht es auch mal was rauher zu“ abgekanzelt werden.
Ich darf mich nicht mehr schlecht fühlen oder Sorge haben müssen, wie damit umgegangen wird, wenn ich dem Fußballkreis einen Diskriminierungsfall melde. Oft wird dir dann das Gefühl vermittelt: „Ach der schon wieder, regt sich wegen jeder Kleinigkeit auf.“ Wenn ich den Diskriminierungsfall eines Schiedsrichters melde, der einen abfälligen Kommentar gegenüber einer kopftuchtragenden Spielerin abgibt, dann habe ich Sorge, dass ich folgende Antwort bekomme: „Ach, das hat der Dieter sicher nicht so gemeint. Das hast du bestimmt falsch verstanden.“
Dr. Thaya Vester berichtet, dass viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen den Aufwand und die sich anschließenden Konflikte meiden möchten, der durch die Erwähnung eines Diskriminierungsfalls im Spielbericht entsteht. Gegen diese Denkart müssen wir konsequent angehen.
Aber wie will man erreichen, dass Vielfalt wertgeschätzt und Diskriminierung bekämpft wird, wenn in den entscheidenden Positionen auf allen Ebenen keine Vielfalt repräsentiert ist? Der DFB muss vorangehen. Er muss klar Position beziehen, etwa so: „Diskriminierung jeglicher Form hat bei uns keinen Platz. Jeder Form der Diskriminierung wird nachgegangen und sie zieht konsequente Strafen nach sich.“ Im gleichen Zug muss der DFB all seinen Mitgliedsvereinen authentisch vermitteln: „Egal wie ihr heißt, wie ihr euch zusammensetzt, welchen kulturellen, religiösen oder nationalen Schwerpunkt ihr habt, solange ihr euch an die geltenden Regeln und Werte im Sport und in der Gesellschaft haltet, seid ihr uns herzlich willkommen und wir sehen euch als Teil des Deutschen Fußballs.“
Diese Botschaften müssen allerdings mehr als Lippenbekenntnisse sein. Hochglanzkampagnen hatten wir genug. Kleinreden oder wegschauen machen es nur schlimmer. Wir brauchen konkrete Maßnahmen in der Praxis, die die ernstgemeinten Botschaften unterstreichen.
Welche konkreten Maßnahmen das sein können und was die Vereine an der Basis tun können, um Diskriminierung präventiv anzugehen – dazu werde ich mich in meiner nächsten Kolumne äußern.
Protokoll: Oliver Fritsch